Interview Tsvi Noefeld
Tsvi Noefeld, ältester Sohn von Moshe Neufeld, ist der Bruder von Oded Neufeld und der älteren Schwester Rachel Nusinow. Er wohnt, wie Oded, im Kibbuz Barkai.Wir erfahren, wie er das Schicksal seines Vaters Moshe Neufeld als Sohn wahrgenommen hat und damit umgegangen ist.
Das Interview mit ihm wurde, wie mit Bruder Oded, im Raum der KZ-Gedenkstätte durchgeführt. Die beiden Brüder waren anlässlich der Vorstellung des Bildbands „Bilder eines Shoa-Überlebenden“ im März 2019 nach Leonberg gekommen.
Tsvi erlebte den Vater als sehr verschlossenen Menschen mit vielen Stimmungs -schwankungen. Nicht gewalttätig oder laut, aber schwierig und physisch wie auch psychisch nicht gesund. Da er, Tsvi, hauptsächlich im Kinderhaus des Kibbuz aufwuchs und täglich nur zwei bis drei Stunden zuhause bei den Eltern war, wünschte er sich einen Vater wie in anderen Familien auch – nicht unbedingt fröhlich, aber „normal“, aber es sei nicht selten vorgekommen, dass der Vater einfach nur dasaß, schwieg und traurig aussah. Er selber sei dann neben ihm gesessen und habe auch nur geschwiegen. Für ihn und seine Schwester sei das sehr schwierig gewesen; sie konnten es nicht akzeptieren, dass der Vater sich so verhielt, konnten bzw. wollten es auch nicht verstehen und versuchten, dagegen anzukämpfen. Sie dachten, dass der Vater sich doch einfach mal zusammenreißen könnte für seine Familie, für seine Frau, die ihn sehr liebte und wohl am meisten unter seiner Art litt. Sie konnte ja nicht abhauen wie die Kinder, die sich vor dem Schweigen und der Stille zu Freunden flüchteten. Sie hatten z.B. öfter mal vor nach Europa zu fahren, und dann habe er im letzten Augenblick abgesagt, obwohl die Mutter es unbedingt wollte. Das Geld dazu sei ja da gewesen. Auch nach Leonberg zu kommen sei sehr schwer für ihn gewesen und er habe lange gezögert. Der Kontakt zur Ini über das Filmprojekt hätte ihm schließlich etwas von der Angst genommen.
Tsvi sagt, er habe in der Kindheit ständige Traurigkeit und Selbstmitleid über den Tod in der Familie gefühlt. Und er sei auch manchmal eifersüchtig auf andere Kinder gewesen, die zusammen mit ihren Vätern Dinge unternahmen. Sie hätten nur ab und zu etwas mit der Mutter gemacht, wenn sie mal Zeit hatte. Es sei vor allem sie mit ihrer fröhlichen Art gewesen, die das Schweigen des Vaters kompensiert hätte. Sie war es, die sich um die Kinder kümmerte, die von jedem wusste, was er gerne aß oder las. Das Einzige, was der Vater hin und wieder machte, war Essen zubereiten für die Familie.
Aber über den Holocaust mit ihm zu sprechen, war nicht möglich. Er dachte, so Tsvi, dass er der Nabel der Welt sei und ihn alle in der Familie verstehen müssten, ohne dass er etwas sagte. Erst viel später erklärte er, warum er nicht darüber sprach: er war sich sicher, dass ihm niemand glauben würde/geglaubt hätte und er sie gelangweilt hätte. Es gab ja viele Leute im Kibbuz, die aus Amerika gekommen waren und den Holocaust nicht erlebt hatten. Der Vater habe versucht ihnen von seinen Erlebnissen zu erzählen, aber sie glaubten ihm das nicht. Deshalb hörte er dann auf, darüber zu sprechen.
Auch am jährlichen Holocaustgedenktag im Kibbuz habe er nur geschwiegen. Bei einem dieser Anlässe sei er mal gebeten worden, etwas zu basteln, woraus sich schließlich sein Interesse an Kunst entwickelt habe. Und er habe ein wirkliches Talent dafür gehabt. Das hätten sie sofort erkannt. Denn nach Besuchen in Ausschwitz und anderen Stätten, an denen der Vater war, hätten sie diese Orte mit den Darstellungen auf seinen Bildern verglichen und begriffen, dass er sich eigentlich nur über die Malerei ausdrücken konnte. Das war also die Möglichkeit, ihm näher zu kommen. Sein Bruder und er hätten ihm dann auch ein kleines Atelier gebaut.
Der Auschwitzbesuch sei für ihn, Tsvi, persönlich sehr emotional gewesen und habe seine Denkweise gegenüber dem Vater entscheidend verändert. Davor sei er oft sauer auf ihn gewesen, da nicht wie andere Väter war sondern wie ein Schatten, der sich nicht um die Kindern kümmern konnte, da er so mit sich selbst beschäftigt gewesen sei. Danach habe der Vater wohl versucht, sich zu ändern, aber so richtig sei ihm das nicht gelungen – höchstens gegenüber Oded und später mit dem Enkel (mit dem er vergleichsweise viel über das Thema geredet hat) Denn er habe sicher gemerkt, dass sich die Kinder sonst vielleicht gegen ihn wenden könnten. Definitiv hätte Oded eine andere Kindheit als die beiden älteren Geschwister gehabt.
Für die Schwester sei es in dieser Zeit wichtig gewesen, nicht so oft zuhause zu sein, weil sie die Atmosphäre nicht ertragen konnte. Er aber wollte unbedingt nachhause kommen wegen seiner Mutter und weil ihm der Vater leid tat. Der sei zwar in Psychotherapie gewesen und habe Pillen genommen, und die Mutter glaubte, die Therapie würde ihm helfen. Es waren sicher innerliche Dinge in ihm vorgegangen, die vielleicht der Doktor wusste, oder auch die Mutter, so Tsvi. „Aber da er nie darüber sprach, hatten wir keine Ahnung, wie es in ihm aussah“.
Auch wenn er und die Schwester mit der Mutter versucht hätten darüber zu reden, hätten die Eltern die Hilfe von sog. Holocaust-Sozialarbeitern angenommen. Sie als Kinder hätten das wohl mitbekommen, aber nicht gewusst, warum. Jetzt ist ihm klar, dass solche Profis natürlich viel mehr herauskitzeln können als die eigenen Kinder. Die Mutter habe in dieser Zeit sehr viel geweint und er bezweifelt, ob das Konzept des ständigen darüber Redens so gut war.
Er, Tsvi, selber wollte nie zum Psychologen gehen, auch wenn er glaubt, dass er möglicherweise irgendeine Art Trauma hat. Aber er weiß nicht, wie groß, da ihm die Vergleichsmöglichkeit fehlt. Ein Teil dieses Traumas ist sicher die Angst, dass so etwas wie der Holocaust wieder passieren könnte. „Es fühlt sich für mich so an, als seien wir immer noch in einem Überlebenskrieg.“ Er will mit der Schwester darüber reden, denn sie ist Psychologin und sie haben beide ein gutes Verhältnis zueinander. Ansonsten redet er nur noch mit seiner Frau darüber, die übrigens ein besseres Verhältnis zu seinem Vater hatte als er, der Sohn.
In den letzten Jahren seines Lebens, als er schon krank war, setzte sich die Schwester lange mit dem Vater zusammen und versuchte seine Biografie zu schreiben. Sie hatte dafür extra Kurse für Interviewtechnik an der Uni belegt. Der Vater begann selber auch aufzuschreiben. Sie hatte auch die Idee, daraus ein Buch zu machen.
Schließlich begann auch er darüber zu sprechen, nämlich als er merkte, dass junge Leute sich dafür interessierten und ihm glaubten. Dieser Wandel kam durch sein Engagement in der Jugendarbeit zustande, als er u.a. auch Schulen besuchte und vor Schülern sprach – so wie andere Überlebende aus dem Kibbuz auch. Das war aber erst ein paar Jahre vor seinem Tod.
Tsvi glaubt, dass der Vater seine Liebe zu den Kindern nur anderen gegenüber zugeben konnte und nicht direkt gegenüber ihnen selber. Ob er mit der Mutter über innerste Dinge gesprochen hat, wagt Tsvi zu bezweifeln. Für ihn als Sohn sei es jetzt einfacher, über emotionale Dinge zu sprechen als früher, als er noch sehr abhängig war vom Vater und keine eigene Familie hatte.
Direkt nach dem Tod des Vaters hätten sie in der Familie mehr über das ganze Thema gesprochen, später aber meist nur noch einmal im Jahr an seinem Todestag. Sie sprächen auch mit den Enkeln darüber, aber nicht die ganzen harten Geschichten. Die Enkel sollten ihn als guten Großvater in Erinnerung behalten. In der Schule werde ständig über das Thema Holocaust geredet, aber nur im Sinne von geschichtlichem Faktenwissen, ohne persönlichen Bezug. Er, Tsvi, habe als Kind kaum etwas darüber erfahren, und das obwohl es ja den Holocausttag gab/gibt. Er hätte den Vater schon mal gefragt, wie er eigentlich die Nummer auf dem Arm bekommen habe, aber nie, wie sich das anfühlte.
Jetzt verwaltet die Schwester alles – seinen Lebensbericht und seine Bilder, wofür er, der Bruder, sehr dankbar sei. Mit den Bildern allerdings sei es nicht einfach. Sie hätten versucht die Sammlung im Ganzen an Yad Vashem abzugeben, aber dort gebe es nicht genug Platz: „Israel ist überall voll von solchen Sachen und es gibt nicht genug Geld, um die Gedenkstätte zu erweitern“. So sind die Bilder also immer noch bei der Schwester privat gelagert, aber wenn man sie nicht professionell aufbewahre, dann gingen sie irgendwann kaputt.
Er macht sich immer wieder Gedanken darüber, ob auch Generationen nach ihm noch vom Holocaust beeinflusst werden. Auch wenn die Nachkommen regelmäßig zum Holocaust-Tag kämen, so seien sie doch zeitlich einfach schon sehr weit entfernt davon.
Auf jeden Fall findet er, dass Erinnerung sehr wichtig ist, auch dass Gegenstände aus dieser Zeit aufbewahrt würden.
Gewundert hat ihn beim Besuch in unserer Gedenkstätte der Umgang mit solchen Memorabilia, z.B. dass man die Häftlingskleidung einfach so offen sehen könne. In Israel würden diese Sachen weggeschlossen, sie seien sozusagen heilig.
Auch wenn seine Einstellung zum Kibbuzsystem zwiespältig ist – man war der eigenen Familie entzogen und es war deshalb schwieriger eine Beziehung aufzubauen - so sieht er sein Aufwachsen dort in der Rückbesinnung doch auch als etwas Positives. Er habe viele gemeinsame Aktivitäten erlebt, die normalerweise vielleicht der Vater mit ihm hätte machen können. Für ihn sind die ehemaligen Kinder aus seiner Gruppe heute wie eine große Familie, mit der man sich regelmäßig trifft.
Für ihn ist es wichtig, sich für die Verteidigung Israels zu engagieren, des einzigen Landes für Juden, und das sei etwas, was er von seinem Vater gelernt habe. Der habe ja schon in den 50er-Jahren während der Suez-Krise für Israel in den Krieg ziehen müssen. Diese Einstellung sei einem aber auch im Kibbuz vermittelt worden. Die Holocaustüberlebenden hätten den Aufbau des jüdischen Staates als zentrale Aufgabe gesehen und diesen Gedanken auch auf die Kinder übertragen. Der Vater sei daher auch sehr stolz gewesen, dass Oded bei der Armee war.
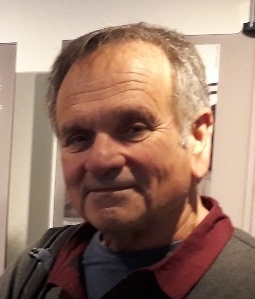
Weiterführende links
Biografie Moshe NeufeldInterview mit Oded Neufeld
Nachruf auf Moshe Neufeld (7. Juli 1926 – 4. Januar 2008)
Buchvorstellung in Leonberg
Moshe Neufelds Bilder als Buch
Das Grauen lässt die Opfer nie wieder los - Moshe Neufeld bannt den Holocaust in Bilder
Moshe Neufeld – Bilder eines Shoa-Überlebenden